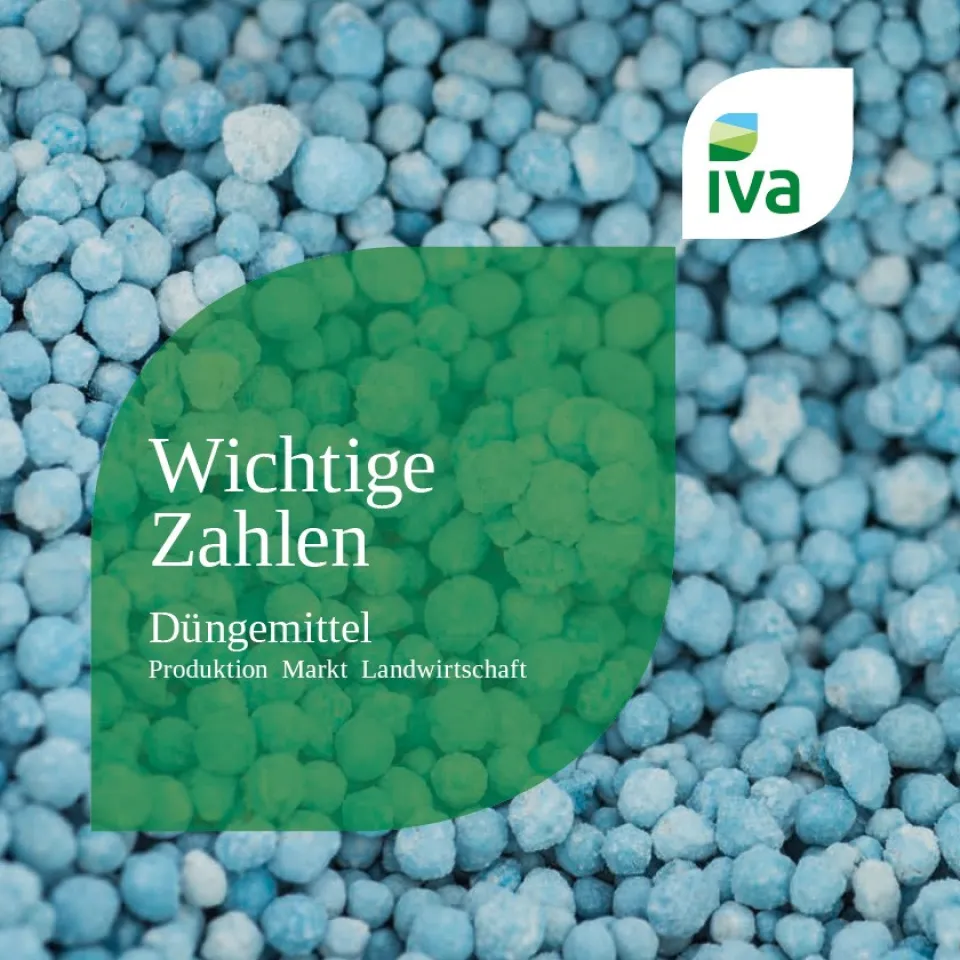#WirsindTeilderLösung
Für Klima, Umwelt und Ernährungssicherheit – im Dialog mit Politik, Wissenschaft, Medien und Landwirtschaft.
Aktuelles
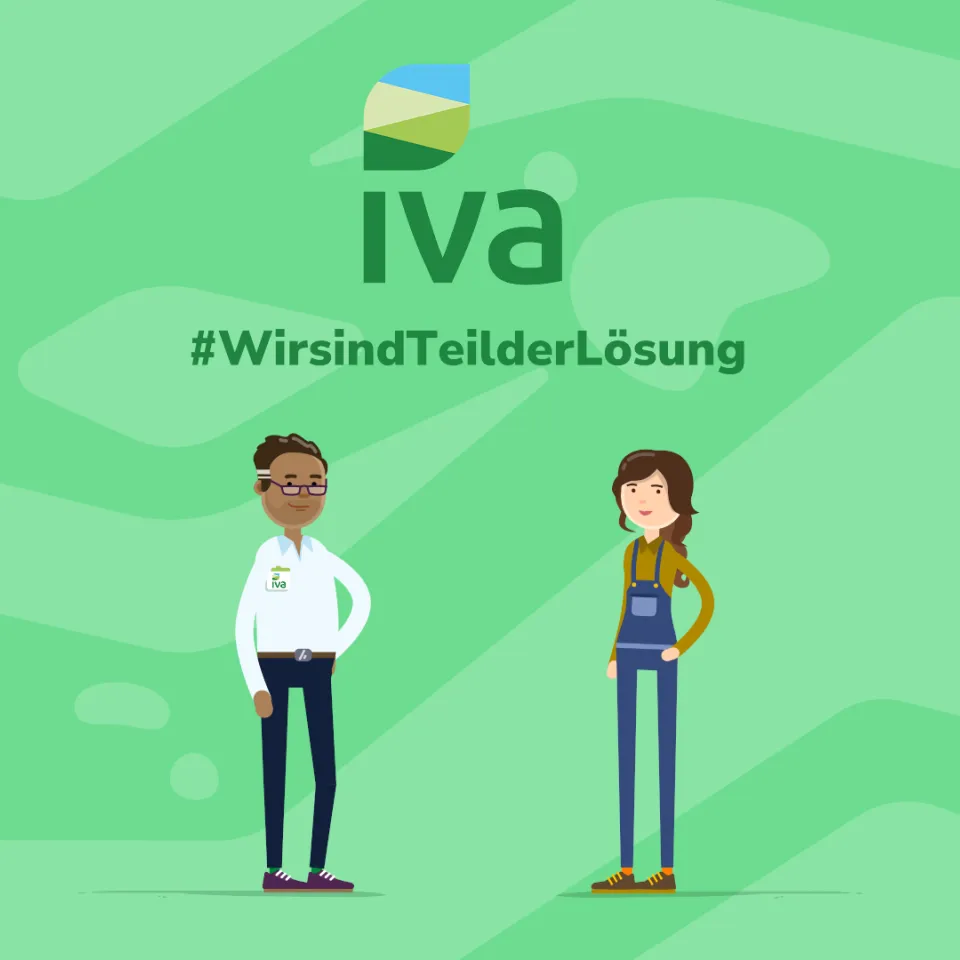
#WirsindTeilderLösung
Wie trägt die Agrarchemie zu zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen wie Klima- und Umweltschutz sowie Ernährungssicherheit bei?

Wir sichern Ernährung
Moderne Landwirtschaft hat dazu beigetragen, dass der Ertrag und die Qualität der landwirtschaftlichen Produkte in den letzten Jahrzehnten erheblich gestiegen sind.

Unsere Politik- und Positionspapiere
Der IVA steht für einen offenen Austausch und für Transparenz in seinen Positionen und Forderungen.

Der Verband
Die vom IVA vertretene Branche bietet innovative Produkte für eine moderne Landwirtschaft, professionellen Gartenbau und verantwortungsvolle Privatanwendung.

Fachgebiete
Die 47 Mitgliedsunternehmen des IVA engagieren sich in den Bereichen Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung.