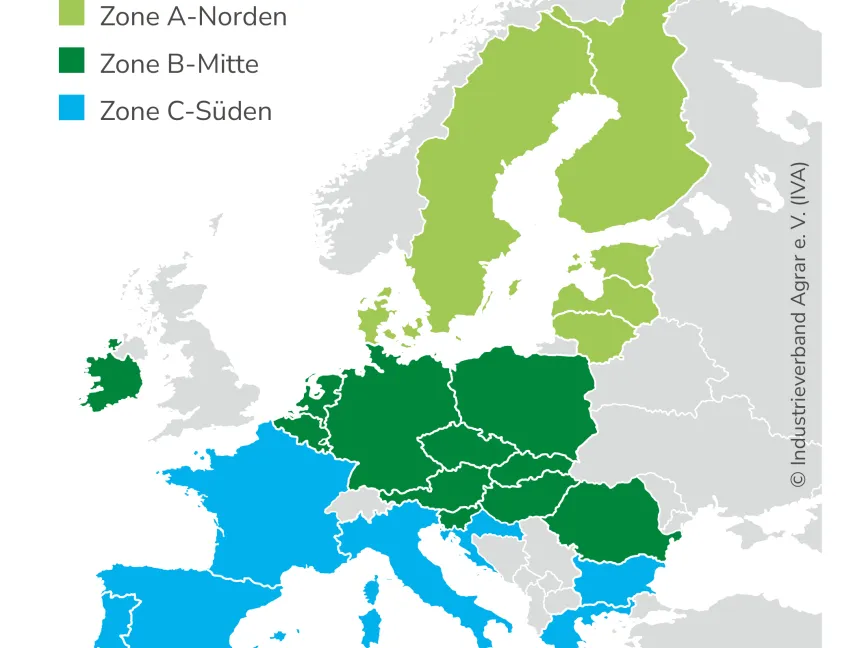Neuigkeiten zum Verband und seinen Themen
Aktuelles
Pressebilder
© Industrieverband Agrar e. V. (IVA)
5.23 mb - .jpeg
Martin May, IVA
Geschäftsführer, Leiter Kommunikation und Politik
© Industrieverband Agrar e. V. (IVA)
988.16 kb - .jpeg
Pflanzenschutzmittel-Zulassung in Europa
Zonale Zulassung
Pressekontakt
Haben Sie Fragen? Sprechen Sie uns gerne an.

Martin May
Geschäftsführer, Leiter Kommunikation und Politik, Pressesprecher
+49 69 2556-1249

Maik Baumbach
Stv. Pressesprecher, Publikationen
+49 69 2556-1268