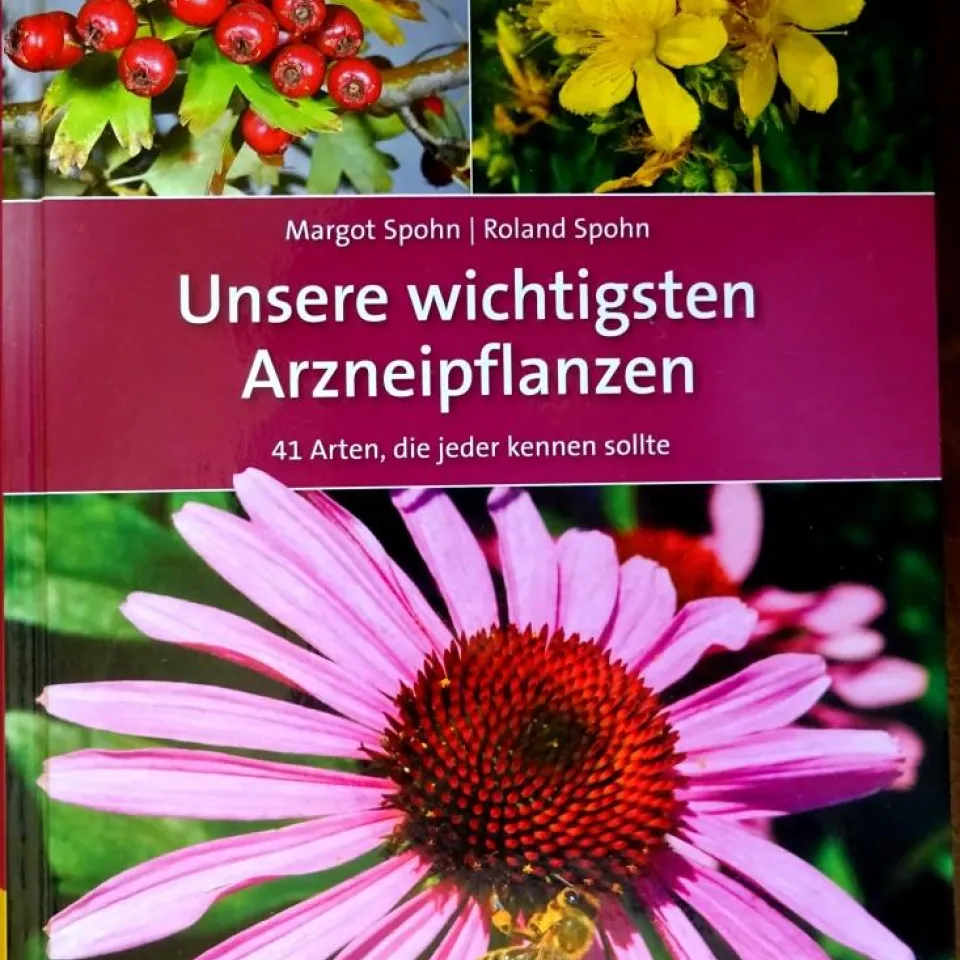Die Schafgarbe ist „Arzneipflanze des Jahres 2025“

Die Schafgarbe ist „Arzneipflanze des Jahres 2025“
Wirkt bei Bauchkrämpfen und unterstützt die Wundheilung
Millionen Schafe können nicht irren: Die Schafgarbe schmeckt lecker, obwohl sie neben aromatischen auch bittere Komponenten enthält. Doch das war nicht der Grund, warum das weißblühende Kraut zur „Arzneipflanze des Jahres 2025“ gekürt wurde. Der Grund dafür war vielmehr ihre pharmazeutische Wirkung. Sie wird traditionell gegen Verdauungsbeschwerden, menstruationsbedingte Krämpfe und zur Wundheilung eingesetzt. Im Volksmund heißt sie deswegen auch Bauchwehkraut, Achilleskraut oder Jungfrauenkraut.
Jedes Jahr kürt der interdisziplinäre Studienkreis „Entwicklungsgeschichte der Arzneipflanzenkunde“ am Institut für Geschichte der Medizin der Universität Würzburg eine Arzneipflanze des Jahres. 2025 ist es die Gemeine Schafgarbe (Achillea Millefolium). Botanisch gehört die Gattung Schafgarbe zur Familie der Korbblütler (Asteraceae). Die ausdauernde, krautige Pflanze wächst in Europa, Asien und Nordamerika am liebsten auf nährstoffreichen Böden und kann bis zu 80 Zentimeter hoch werden. Die Schafgarbe ist ein Stickstoffzeiger und erschließt sich neue Flächen durch ihre ausdauernden Rhizome als Wurzelkriecher. Sie blüht weiß bis rosa mit doldig angeordneten Blütenkörbchen.
Die Wirkstoffzusammensetzung schwankt
In der Medizin werden zumeist die frischen oder getrockneten blühenden Triebspitzen verwendet. Wenn die Droge in Apothekenqualität verwendet werden soll, muss sie die Qualitätsnormen des „Europäischen Arzneibuchs“ (EuAB) erfüllen, bei denen unter anderem die Reinheit und der Anteil sowie die Qualität und Zusammensetzung der wertbestimmenden ätherischen Öle und des Gehalts des Inhaltsstoffs Proazulen gemessen wird. Oft stammen die Schafgarben für die Arzneigewinnung aus Wildsammlungen in osteuropäischen Ländern, teilweise aber auch aus dem spezialisierten Arzneipflanzenanbau. Die Inhaltsstoffe sind sehr komplex zusammengesetzt. So findet man neben dem ätherischen Öl auch Flavonoide, Cumarine und Phenolcarbonsäuren in der Schafgarbe. Auch schwanken die Inhaltsstoffe in der Menge und in ihren Anteilen.
Verwendung äußerlich und innerlich möglich
Krampflösend, antibakteriell, gallentreibend, adstringierend – so könnte man die Wirkung von Schafgarbe auf den menschlichen Organismus beschreiben. Innerlich wird ein Tee oder Aufguss aus Schafgarbe gegen Appetitlosigkeit und bei Bauchkrämpfen eingenommen. Die gallentreibende Wirkung rührt vermutlich von den bitteren Sesquiterpenen her. Äußerlich werden wässrige Extrakte und alkoholhaltige Tinkturen zur Wundheilung aufgetragen. Die in der Schafgarbe enthaltenen Proazulene haben eine antibakterielle Wirkung. Bei Menstruationsbeschwerden können auch Sitzbäder mit Schafgarbenextrakt helfen, die Krämpfe und Spannungszustände im Becken zu lindern.