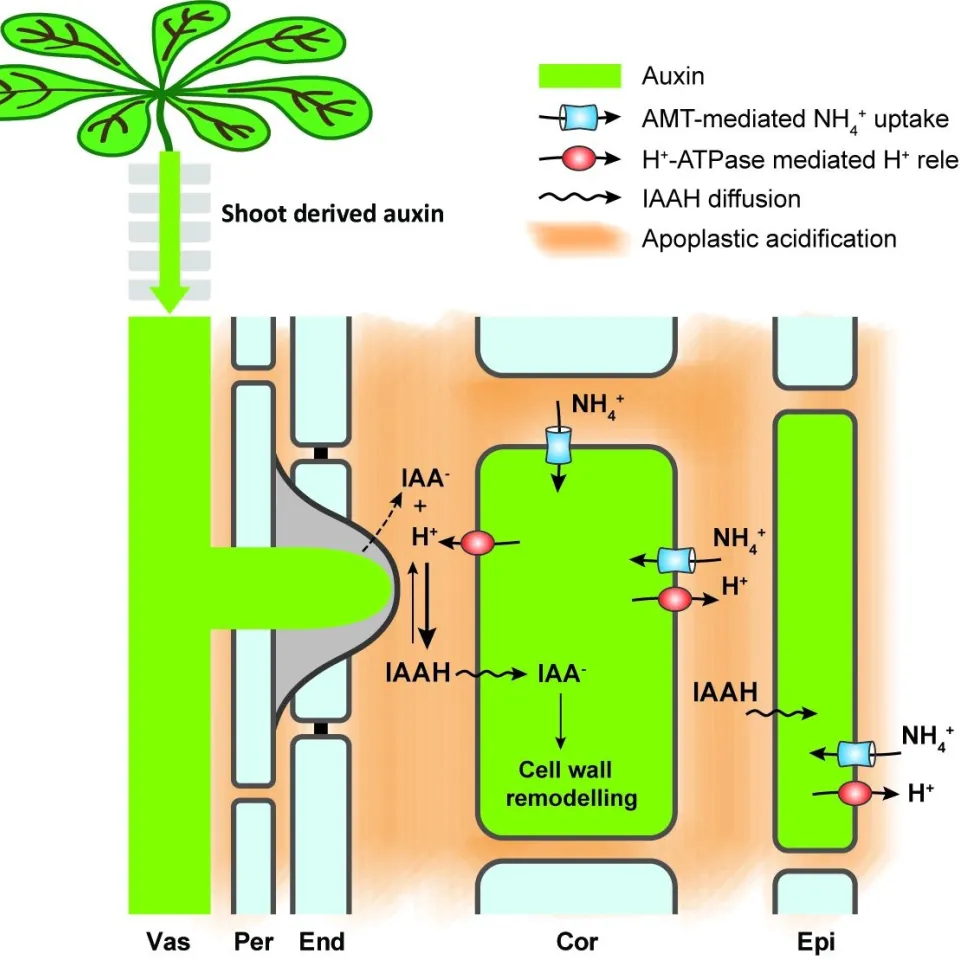Serie: Nachhaltigkeit im Pflanzenbau
Teil 3: Den Boden so wenig wie möglich bearbeiten und so lange wie möglich begrünen
Wenn es um die Nachhaltigkeit von Pflanzenbausystemen geht, dann gibt es eine Vielzahl aktueller Kontroversen und Zielkonflikte. Ein jüngst erstelltes Grundlagenpapier der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften e. V. nimmt zu unterschiedlichen Aspekten der Nachhaltigkeit des landwirtschaftlichen Ackerbaus Stellung. Teil 3 unserer Serie (siehe Teil 1, Teil 2) behandelt das Thema Bodenschutz landwirtschaftlich genutzter Böden.
Landwirtschaftlich genutzte Böden sind sehr unterschiedlich und müssen daher auch unterschiedlich behandelt werden. Der Boden ist als Wasser- und Nährstoffspeicher für die Kulturpflanzen einer der wichtigsten Faktoren im Pflanzenbau. Gleichzeitig ist er aber auch Lebensraum für Tiere, Wildpflanzen und Mikroorganismen. Gefahr für den Boden entsteht durch Wasserabtrag/Erosion, Verdichtungen durch schweres Gerät bis hin zu Schadstoffeinträgen. Wenn Landwirte ihre Böden bewirtschaften, dann haben sie den Erhalt und die Verbesserung der Standortfunktion Boden für die Kulturpflanzen im Auge und führen dafür pflanzenbauliche Maßnahmen wie Bodenbearbeitung, mechanische Unkrautbekämpfung, Düngung und Bewässerung auf ihren Flächen durch. Diese können aber auch unerwünschte Wirkungen auf andere Ökosystemfunktionen wie die Habitatfunktion für Bodenlebewesen und Wildpflanzen haben. Um diese Zielkonflikte zu vermindern oder zu umgehen und Lösungen aufzuzeigen, hat die Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften ein Grundlagenpapier zur Nachhaltigkeit im Pflanzenbau erstellt.
Das Problem im Hinblick auf die Böden stellen die Autoren wie folgt dar:
- Klimaveränderungen wie Trockenheit oder Starkregen erhöhen die Wassererosion von Böden.
- Intensive Bodenbearbeitung und schwere Erntemaschinen können zu Bodenverdichtungen führen, die sich bis in den Unterboden negativ auswirken.
- Die ökonomischen Rahmenbedingungen erfordern eine hohe Schlagkraft und Flächenleistung, sodass Feldarbeiten nicht immer zeit- und „bodengerecht“ auf nicht tragfähigem Boden durchgeführt werden können.
- Es entsteht ein Zielkonflikt zwischen der erwünschten Biodiversitätsförderung durch Reduktion der mechanischen Unkrautbekämpfung und der kurzfristigen Produktivität.
Die Wissenschaftler gehen auch auf den Einsatz von Totalherbiziden vor der Saat ein: Dieser erlaube es, die Bodenbearbeitungsintensität zu reduzieren und damit das Erosionsrisiko, den Eintrag von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln in Oberflächengewässer, die Verdichtungsgefährdung sowie den Energieverbrauch zu vermindern. Zudem spare eine reduzierte Bearbeitungsintensität Arbeits- und Maschinenkosten ein, so die Autoren.
Den Bodenschutz voranbringen
Bodenschutz lässt sich zum Beispiel durch den konservierenden Ackerbau mit Mulch- und Direktsaatverfahren erreichen. Viele Studien zeigen, dass diese Verfahren sehr effiziente Bodenschutz-Maßnahmen darstellen, weil sie die Wind- und Wassererosion und damit auch Phosphor-Abträge verringern. Positiv, so die Autoren, ist auch der im Vergleich zur Bewirtschaftung mit dem Pflug geringere Energie und Arbeitsbedarf. Allerdings sind sie oft mit etwas niedrigeren und auch schwankenden Erträgen verbunden. Negativ können bei der konservierenden Bodenbearbeitung auch die etwas höheren Stickstoff-Verluste und die geringer Stickstoff-Effizienz zu Buche schlagen. Auch ist die Abhängigkeit von externen Betriebsmitteln wie Pflanzenschutzmitteln vor allem bei den Direktsaatverfahren höher, weil die gegebenenfalls mehrmalige und/oder wendende Bodenbearbeitung als Unkrautbekämpfungsmaßnahme wegfällt.
Konservierender Ackerbau als Maßnahmenkatalog
Als eine mögliche Lösung propagieren die Forscher das System des Konservierenden Ackerbaus (Conservation Agriculture) als eine Weiterentwicklung konservierender Bodenbearbeitungssysteme. Er beinhaltet neben der konservierenden Bodenbearbeitung oder Direktsaat eine weite Fruchtfolge sowie kontinuierliche Bodenbedeckung durch möglichst umfassenden Anbau von Zwischenfrüchten. In diesem System sollen somit die negativen Effekte einer verminderten Bodenbearbeitungsintensität durch Erhöhung der Diversität ausgeglichen werden, prognostizieren die Autoren.
Fazit
Die Produktionsfunktion landwirtschaftlicher Böden ist nur einer, wenn auch zentraler Teil der Ökosystemdienstleistungen, die ein Agrarökosystem erbringt. Gleichzeitig müssen auch die Belange des Natur- und Umweltschutzes bei der landwirtschaftlichen Nutzung von Böden berücksichtigt werden. Im konservierenden Ackerbau wird versucht, die Vorteile einer nichtwendenden Bodenbearbeitung wie verminderte Bodenerosion und besseres Wasserhaltevermögen durch eine vielfältige Fruchtfolge und dem Anbau von Zwischenfrüchten zu unterstützen.
Quelle: JKI