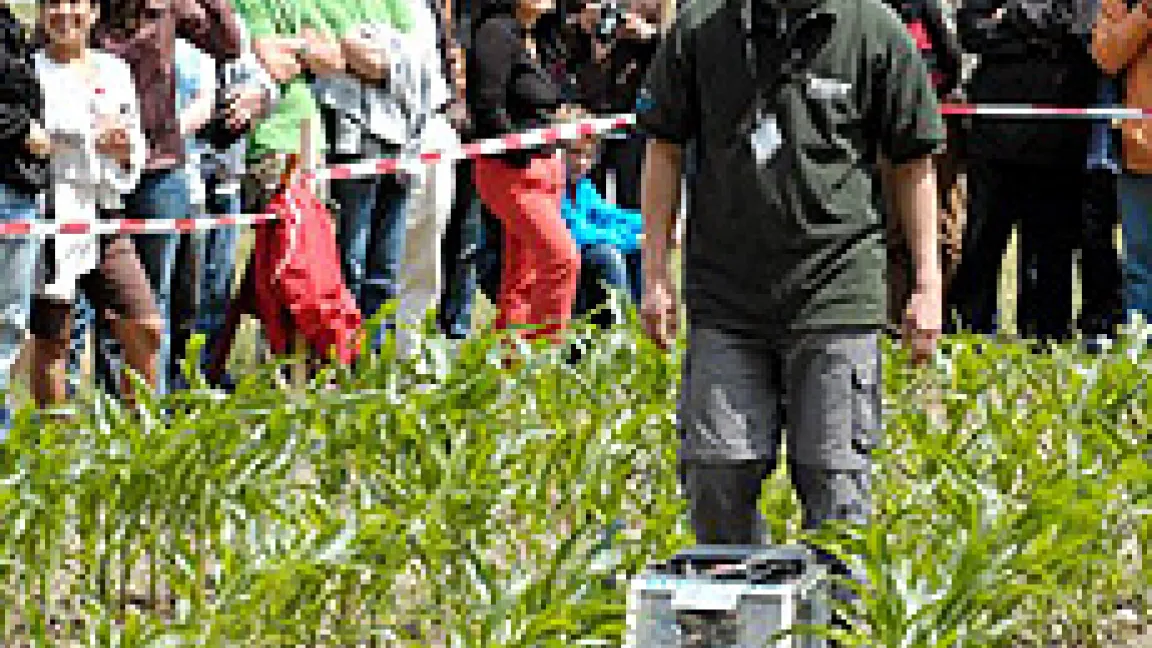Roboter im Ackerbau: Deutsches Team Vizeweltmeister im Mehrkampf
Bei der Weltmeisterschaft der Feldroboter hat die Zukunft schon begonnen
Hier zeigen junge Forscher Landtechnik von morgen. Field Robot Event heißt die inoffizielle Weltmeisterschaft für Feldroboter. In diesem Jahr belegte das Team der TU Braunschweig in Osnabrück den zweiten Platz. Der Titelverteidiger aus dem Jahr 2007 musste sich trotz technischer Verbesserungen an seinem Modell Helios dem Team 4M aus Helsinki (Finnland) geschlagen geben. Den dritten Podestplatz errang die Universität Wageningen (Niederlande). Insgesamt waren 15 Teams aus dem In- und Ausland für die inoffiziellen Weltmeisterschaften für Feldroboter gemeldet.Fünf Disziplinen
Helios zeigte in allen fünf Disziplinen gute Leistungen. Der vierrädrige Roboter fuhr unter anderem selbständig durch geschwungene Maisreihen, wendete am Reihenende, fand Unkraut symbolisierende Golfbälle im Maisacker und zählte Maispflanzen.
In der Freestyle-Disziplin sollten die übrigen Teilnehmer überrascht werden: Geplant war, dass Helios eine Blume in einer bestimmten Farbe sucht und den Standort per Funk an seinen Zwilling Helios II durchgibt. Helios II sollte dann unverzüglich die Blume ansteuern und besprühen. Leider kam die Funkverbindung nicht zustande, so dass die Juroren nur die Idee bewerten konnten.
Mit Schnurrbarthaaren Hindernisse erkennen
Gegenüber dem Vorjahr hatte die Osnabrücker Projektgruppe ihren Helios mit einem neuen Laserscanner, mechanischen Schnurrbarthaaren links und rechts am Fahrzeug und einem CAN-System* zur Vernetzung von Steuergeräten deutlich aufgerüstet. Die Höchstgeschwindigkeit des bis zu 20 Kilogramm schweren Fahrzeugs beträgt rund zehn Stundenkilometer. Der Antrieb erfolgt fast geräuschlos mit Hilfe eines Elektroakkus. Etwas lauter ging es bei einem Team aus Dresden zu: Hier kam ein Benzinmotor aus einem Rasenmäher zum Einsatz.
Landtechnikunternehmen aufmerksam
Was zunächst wie eine technische Spielerei wirkt, kann bei gezielter Weiterentwicklung kommerziell interessant werden. Nicht umsonst engagierten sich bedeutende Landtechnikunternehmen als Sponsoren der Teams. Für die jungen Forscher bot das Event zudem die Möglichkeit, Erfahrungen in der Projektarbeit zu sammeln und statt grauer Hörsaal-Theorie auch Praxisnähe zu proben.
* CAN-Systeme dienen in der Automatisierungstechnik zur Übertragung von Informationen zwischen den einzelnen Komponenten eines Systems. Die Abkürzung steht für Computer Area Network
Mehr zum Thema unter www.fredt.de.